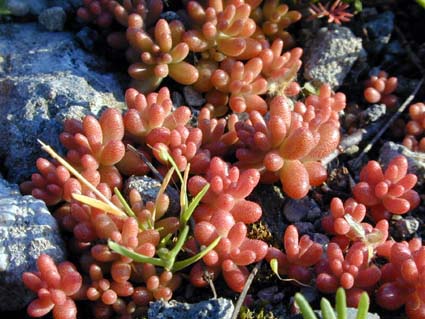Alchemilla mollis (Alchemilla vulgaris)
Der Frauenmantel ist eine bei uns heimische Pflanze aus der Famile der Rosengewächse. Sie hat zahlreiche, verschiedene populäre Namen. Solche sind neben Frauenmantel auch Alchemistenkraut, Aller Frauen Heil, Frauenhut, Frauenhaarmantel, Frauenkraut, Frauenrock, Frauentrost, Frauenwurzel, Gänsefuß, Gewittergras, Hergottsmäntelein, Himmelstau, Jungfernwurz, Löwenfußkraut, Mantelkraut, Marienblümli, Marienkraut, Marienmantel, Muttergottesmantel, Perlkraut, Regendachl, Regendächle, Sintau, Synnaw, Sonnenthau,Taubecher, Taublatt, Taufänger, Taumantel, Taurosenkraut, Tauschüsserl, Tränenschön, Unser Frowen Mantel, Wasserträger, Weiberkittel, Wiesensinau.
Der Frauenmantel ist eine mit viel Mystik und vielen Deutungen und Bedeutungen behaftete Pflanze, eine Pflanze, welche die Fantasie unser Vorfahren reichlich gekitzelt hat und so, wie ich bei der Durchsicht der Einträge im Internet sehe, auch heute noch so manchem Quacksalber zum unredlichen Einkommen verhilft.
Der botanisch Name leitet sich vom Arabischen "alkemelych" über Griechisch "alkhymeia"(Alchemie) ab. Einige der populären Namen weisen auf die Verwendung der Pflanze bzw. ihrer Teile in der Volksmedizin hin. So soll Alchemilla z.B: gegen ‚Frauenleiden‘ helfen. Dies nicht nur im naheliegenden Sinne sondern auch:
"Wenn eine Frau, die weiche Brüste hat, in die Badstube geht und im Ausgang ein mit Sintau (althochdeutsch: Immertau) genetztes Tüchlein überlegt, bekommt sie straffe Brüste".

Auch die Jungfräulichkeit ließ sich damit wieder herstellen. (Jungfernwurz)
Die Allchemisten benutzten die Guttationstropfen der Alchemilla zur Herstellung des ‚Stein der Weisen‘
Das will ich aber hier nicht vertiefen. Lediglich Namen wie Gewittergras, Perlkraut, Sintau, Sonnenthau, Taubecher, Taublatt, Taufänger, Taumantel, Taurosenkraut, Tauschüsserl, Tränenschön, Wasserträger finden hier unser Interesse. Diesen Namensgebungen und der Tatsache, dass diese Pflanze als Wetteranzeiger galt, will ich im Folgenden auf die Spur kommen.
Schaut man auf eine solche Pflanze, fällt einem oft auf, dass sich in der Mitte des Blattes ein auffälliger, Perlen gleicher, im Licht schillernder, dicker Wassertropfen befindet. Dies ist manchmal das Ergebnis von Guttation, manchmal von Tauniederschlag oder auch von Regenniederschlag. Solch ein dicker Wassertropfen verdunstet wesentlich langsamer als ein Wasserfilm. Dadurch glitzert er noch in der Blattmitte, wenn rundherum alles schon abgetrocknet ist.
Aber er bildet sich eben auch, ohne dass es taut oder Regen fällt, rein als Ergebnis von Guttation.
Was ist Guttation?
Sieht man sich einen Baum an, so wird deutlich, dass nicht geringe Kräfte wirken müssen, um Wasser bzw. Nährlösungen von der Wurzel bis in die Blätter im Kronenbereich zu fördern. Hierbei spielen viele Faktoren zusammen. Darunter sind der Wurzeldruck (Turgordruck), Kapillarität (Wasser steigt in engen Röhren auf Grund der Adhäsion an den hier Zell- bzw Leitungsbahnwänden hoch), sowie eine Sogwirkung, die sich aus dem Unterschied des Systemdrucks, der innerhalb der Pflanze herrscht, herleitet, wobei in den Verdunstungsorganen (zumeist den Blättern) eben durch Verdunstung ein geringerer Druck als in der übrigen Pflanze entsteht und somit den ununterbrochenen Wasserstrom (wie z.B. ein Unterdruck der Luft von Luft höheren Drucks in der Umgebung ausgeglichen wird) anzieht. In Wirklichkeit ist die Sache noch etwas komplexer. Das aber sollte hier reichen.
Blätter haben auf der Blattunterseite zahlreiche Spaltöffnungen (Stomata). Diese stellen eine Verbindung zur Außenwelt her, während der Rest eines Blattes durch seine Epidermis und eventuell eine Kutikula abgeschlossen ist. Unter anderem dienen sie dazu, überschüssiges Wasser und darin gelöste Stoffwechselprodukte in die Umgebung abzugeben. Das funktioniert normalerweise durch Verdunstung. Diese Spaltöffnungen haben einen Öffnungs- bzw. Schließmechanismus, können ihre Öffnung also den Bedürfnissen und Gegebenheiten anpassen. Nicht zuletzt wird hierdurch auch eine Temperaturregelung, zumindest eine Kühlung bei hohen Temperaturen erreicht. (Verdunstungskälte) Ist die umgebende Luft jedoch mit Feuchtigkeit gesättigt, funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. In mit Feuchtigkeit gesättigte Luft kann keine Flüssigkeit mehr abgegeben werden.
Die Pflanze hat aber nach wie vor einen Stoffwechsel und ist auf Wasser- bzw. Nährlösungstransport angewiesen. Jetzt kommt es zur Guttation. Unter Guttation versteht man die Abgabe von Wasser in Tropfenform über die sog. Hydathoden. Hydathoden sind den Spaltöffnungen zu vergleichen, sitzen jedoch nicht an der Blattunterseite sondern bei zweikeimblättrigen Pflanzen (Dicothyledonen) an den Blatträndern und bei einkeimblättrigen Pfanzen (Moncothyledonen), z.B. Gräsern an der Blattspitze, also jeweils an den Enden der Leitungsbahnen. Sie verfügen nicht wie die Stomata über einen Schließmechanismus.
Bei Gräsern kann man das fast jeden Morgen deutlich mit bloßem Auge sehen. Oft ist das, was wir Morgentau nennen und, gehen wir früh morgens mit bloßen Füßen über die Gartenwiese, deutlich und meist angenehm spüren, nämlich nicht der Tau der Nacht, sondern es sind eben jene Guttationstropfen. In der Nacht kühlt die am Tag von einer Wassersättigung oft weit entfernte Luft deutlich ab. Das bedeutet, die Wassersättigung innerhalb der Luft steigt, da diese ihr Volumen und damit auch ihr Wasserhaltevermögen reduziert. Außer bei innerstädtischen, völlig mit Wärme speichernden Materialien (Beton, Stein) zugepflasterten und verbauten Arealen, bei denen eine Abkühlung nicht bis herunter zu dem sog. Taupunkt erfolgt, kommt es regelmäßig spätestens in den frühen Morgenstunden zu einer Sättigung der Luft mit Wasser. Dies führt einerseits oft zur Taubildung aber eben auch zu der oben beschriebenen Guttation. Was wir mit unseren bloßen Füßen so angenehm spüren, ist meist das Produkt dieser Guttation. Tau rinnt sehr bald am Blatt ab und bildet keine größeren Tropfen. Guttation hingegen bildet sehr ausgeprägte Tropfen mit einer hohen Oberflächenspannung. Es handelt sich nicht um reines Wasser sondern um eine wässrige Lösung. Diese Tropfen fallen zwar, werden sie zu groß, um sich halten zu können, ab, aber werden sofort durch neue Tropfen ersetzt.
Hier ein Bild aus dem Winter
 Rauhreif ist gefrorener Tau. Zur Taubildung kommt es bei Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit. Dies geschieht meist auf Grund nächtlicher Abkühlung der Luft. Unter Guttation verstehen wir Wasserausscheidungen der Pflanze, die bei Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit aber fortwährendem Stoffwechsel der Pflanze entstehen. Tau kommt von außen Guttation von innen. Der Unterschied lässt sich hier gut erkennen
Frauenmantel, die Wetterpflanze
Rauhreif ist gefrorener Tau. Zur Taubildung kommt es bei Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit. Dies geschieht meist auf Grund nächtlicher Abkühlung der Luft. Unter Guttation verstehen wir Wasserausscheidungen der Pflanze, die bei Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit aber fortwährendem Stoffwechsel der Pflanze entstehen. Tau kommt von außen Guttation von innen. Der Unterschied lässt sich hier gut erkennen
Frauenmantel, die Wetterpflanze
Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Frauenmantel. Bei diesem fallen die Guttationstropfen nicht nur einfach auf die Erde sondern etliche von diesen rollen in das trichterförmige Blatt und sammeln sich auf dem Grund des Blatttrichters in Form einer großen Wasserperle. Da finden wir somit auch an manchen Tagen, obwohl es seit Stunden nicht getaut und lange nicht mehr geregnet hat, diese erstaunlich großen, schillernden Wasserperlen.
Wie weiter oben gesehen kommt es bei hoher Sättigung der Luft mit Wasser zu solcher Guttation. Das kann auch tagsüber geschehen, nämlich immer dann wenn die relative Luftfeuchtigkeit sich den 100% nähert oder diese erreicht. Der Frauenmantel ist eine sehr stoffwechselaktive Pflanze mit ausgeprägten Hydathoden. .
Unsere Vorvorderen haben das natürlich gesehen und so war der Frauenmantel für sie eine Möglichkeit, das Wetter ‚vorauszusagen‘. Bildeten sich im Blatttrichter auffällig Wasserperlen, so, das konnten sie sagen, war schlechtes Wetter zu erwarten. Bei aufkommenden Tiefdruckgebieten erhöht sich die Luftfeuchtigkeit, der Wasserdruck innerhalb der Luft. Es kommt also zur Guttation. Hier hatten unsere Vorvorderen ein lebendes Hygro- und Barometer.

PS: Der Taupunkt wird meist selbst in Wüsten erreicht. (Hohes Temperaturgefälle zwischen Tag und Nacht) Manche der dort spärlich vorkommenden Pflanzen haben da so Tricks. Ein Beispiel sind in die Höhe gestreckte ‚Stacheln‘, an denen der Tau sich absetzt, herunter läuft und in speziellen ‚Kammern‘ aufgefangen wird oder von der Oberfläche aufgenommen wird.. Wird der Taupunkt nicht erreicht, erstirbt fast jedes nicht nur pflanzliche Leben. Ein Schrecken unserer Innenstädte, der jetzt erkannt ist und dem man aber immer noch zu wenig entgegenwirkt.